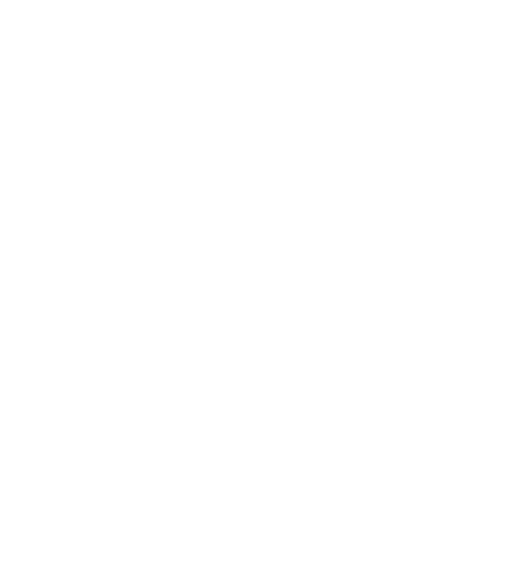«Antiquare hatten die Waren, die die Basler Museen suchten.»
Fünf Fragen an Raphael Selig
Raphael Selig ist Antiquar und führt das Traditionshaus Antiquités Ségal in Basel in sechster Generation. Naomi Lubrich sprach mit ihm über die Beziehungen zwischen Kunsthandel und Museen, über die Anfänge der Judaica in Basel und über den sich verändernden Geschmack für alte Kostbarkeiten.
Naomi Lubrich: Lieber Raphael, Du führst das Antiquariat Ségal in sechster Generation. Wie entstand das Geschäft?
Raphael Selig: Der Sage nach kam der Gründer, Joseph Ségal, Anfang des 19. Jahrhunderts mit Napoleons Soldaten aus dem Elsass nach Basel. Er war ein Hausierer und handelte mit alltäglichen Dingen, wie Teppiche und Biedermeiermöbel. Sein Geschäft währte jedoch nicht lange; mit Napoleons Niederlage endete seine Aufenthaltsbewilligung, wie für viele Juden. 1862, dank besserer Rechtslage für Juden, liess sich sein Sohn Isaak mit seinem Enkel, Berthold, am Spalenberg nieder. Berthold traf es gut: Er erlebte den Museumsgründungs-Boom. In Basel eröffneten das Museum für Völkerkunde (heute: Museum der Kulturen), das Historische Museum und in Zürich das Schweizerische Nationalmuseum. Die Antiquare hatten die Waren, die die Museen suchten, vom Silberkelch bis zum Holzlöffel. Der Kurator des Museums für Völkerkunde, Eduard Hoffmann-Krayer, kaufte schätzungsweise um die 100 Objekte bei Antiquités Ségal binnen zehn Jahren.
NL: Welche Rolle spielte der Handel mit Judaica?
RS: Für unser Haus fiel und fällt der Handel mit Judaica finanziell nicht ins Gewicht. Gleiches gilt für andere jüdische Antiquariatsfamilien. Denn es gab und gibt nur Wenige, die Judaica sammeln. Bekannte Ausnahmen waren die Ephrussis, die Rothschilds und die Oppenheimer. Aber das Judentum spielt durchaus eine Rolle in der Beschaffung: Jüdische Händler hatten ein weites Netzwerk zu anderen jüdischen Händlern über Landesgrenzen hinweg. Ich selber habe einen Partner in London. Das ist ein entscheidender Vorteil für den Einkauf.
NL: Gewisse Leute kauften aber schon damals Judaica.
RS: Diejenigen, die die Gleichberechtigung 1866 erlebten, hatten erstmals finanzielle Mittel und holten nach, was ihren Vorfahren verwehrt war, nämlich der Erwerb schöner Wertgegenstände. Das begann 1870. Sie fertigten neue Ritualgegenstände an; so gab etwa die Israelitische Gemeinde grosse, repräsentative Leuchter, Schriftenrollen und Kiddusch-Becher in Auftrag. Das waren wohlgemerkt Auftragsarbeiten, nicht historische Objekte. Denn Judaica vor dem 19. Jahrhundert sind äusserst selten. Vor allem in Italien gab es ältere Objekte, weil dort die jüdischen Gemeinden wohlhabender waren und nicht so stark von willkürlicher Ausweisung betroffen wie die Gemeinden im deutschsprachigen Raum.
NL: Hat sich der Geschmack verändert?
RS: Ja: Früher kaufte die Kundschaft attraktive Objekte. Heute möchte sie Objekte mit Geschichte: Ein barockes Prunkgefäss bleibt durchaus länger im Regal als ein Holzlöffel mit Emblem oder jüdischer Inschrift. Aber das ist nicht überall gleich. In Frankreich sind «aristokratische» Stücke weiterhin sehr beliebt – im Land der vielen Schlösser vielleicht keine Überraschung. Es gibt neben den regionalen Unterschieden auch generationelle. Unsere häufigsten Kunden sind 60 Jahre alt oder älter, die zweihäufigsten 40 Jahre oder jünger, während Kunden zwischen 40 und 60 ausbleiben. Sie geben ihr Geld lieber anders, zum Beispiel für Ferien, aus. Demographisch sieht man auch einen Wandel: In den 1960er Jahren kauften gutbürgerliche, aber auch einfache Familien Antiquitäten, letztere oft auf Raten. Heute ist die Käuferschaft eher wohlhabend. Sie investiert in Top-Objekte mit Wertbeständigkeit.
NL: Gibt es Schnäppchen, Objekte, deren Wert vielleicht verkannt wird?
RS: Vieles wird heute unter Wert gehandelt. Möbel sind sehr günstig. Viele alte Tische und Kommoden sind handwerkliche Meisterleistungen. Sie werden noch Hunderte Jahre überleben. Judaica im Bauhaus-Stil waren vor zwanzig Jahren ein Geheimtipp, sie sind aber schon im oberen Preissegment angekommen. Aber Landschaftsgemälde sind heute sehr günstig. Was früher für fünfstellige Beträge gehandelt wurde, geht heute für ein paar tausend Franken über den Tisch. Man mag sie langweilig finden, aber das kann sich morgen ändern!
NL: Lieber Raphael, dann schaue ich mir Bilder von Landschaften nun genauer an. Vielen Dank für das Gespräch!
verfasst am 26.04.2023

Dina Epelbaum über die Jüdische Gemeinde Biel