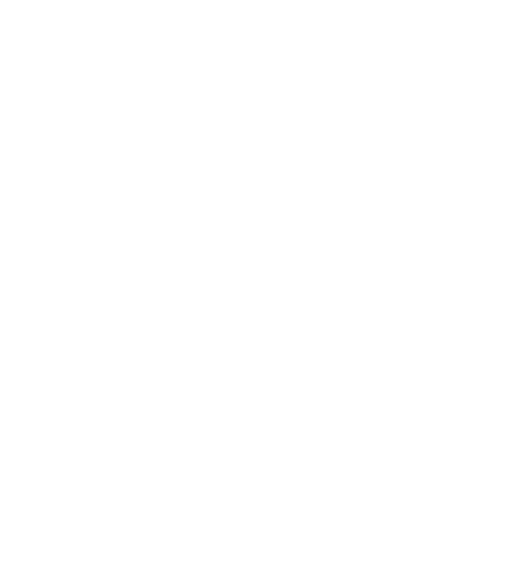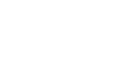«Biel war eine sozialistische, migrantische Arbeiterstadt.»
Dina Epelbaum über die Jüdische Gemeinde Biel
2022 erhielt das Jüdische Museum der Schweiz einen Teilnachlass der Synagoge in Biel/Bienne, darunter Ritual-Textilien, Hüte sowie eine Buntglasfenster-Rosette, die der Lichtfang des kleinen Raumes war. Die gebürtige Bielerin Dina Epelbaum, heute Kuratorin der Kunstsammlungen Baselland, erzählt von der Synagoge ihrer Kindheit, vom Leben der osteuropäischen Einwanderer und von der Kunst, Objekte zusammen mit ihren Geschichten zu bewahren.
Naomi Lubrich: Liebe Dina, erkennst Du diese Buntglasfenster-Rosette?
Dina Epelbaum: Selbstverständlich! Sie war die Lichtquelle über dem Toraschrein der Synagoge in Biel. Sie war ein eindrücklicher Teil meiner Kindheit. Wenn wir die Synagoge besuchten, schaute ich gerne auf die Rosette, wenn meine Gedanken vom Gottesdienst abschweiften. Das Foto dieses feinen Buntglases mit dem floralen Ornament versetzt mich in die 1970er und 1980er Jahre. Ich sehe die mit Menschen gefüllte Synagoge, höre die Gesänge und rieche den eigentümlichen Duft des kleinen Gotteshauses.
NL: Als Kuratorin liest Du Objekte als Zeugnisse ihrer Zeit. Was sagen sie Dir über die damalige Zeit?
DE: Die Objekte stammen aus einer kleinen, aber pulsierenden Gemeinde. Die Synagoge wurde Ende des 19. Jahrhunderts im sogenannten «maurischen Stil» erbaut. Das Haus war klein, aber geschmackvoll eingerichtet und gut instandgehalten. Durch den Aufschwung der Uhrenindustrie kamen viele Jüdinnen und Juden nach Biel. Neben sogenannten «Westjuden» aus dem Elsass, siedelten sich in Biel auch «Ostjuden», jüdische Menschen aus Osteuropa, an, darunter anfangs der 1930er-Jahren mein Grossvater aus der heutigen Ukraine. Ihnen begegnete man mit etwas Skepsis, weil sie mittellos, oft religiös und zionistisch geprägt waren. In Biel trafen sie es gut: Ab 1921 hiess der sozialdemokratische Stadtpräsident Guido Müller Zugewanderte in Biel willkommen und sorgte für günstige und moderne Wohnmöglichkeiten. Biel war damals eine sozialistische, migrantische Arbeiterstadt.
NL: Als Kuratorin engagierst Du Dich für ein gesamtheitliches Sammeln. Du suchst neben Objekten auch deren Geschichten. Wie gehst Du vor?
DE: Objekte werden erst durch ihre Geschichten lebendig. Daher sollte man so viele Informationen wie möglich zeitnah aufzeichnen, denn später lässt sich das oft nicht mehr nachholen. Zunächst würde ich mit Zeitzeuginnen sprechen. In Biel sind es nicht mehr viele, die Gemeinde ist stark geschrumpft. Ich würde sie um Fotos, Briefe, Andenken fragen. Ich würde die Literatur konsultieren, beispielsweise «Heimat Biel» (Chronos 2011), und Ausstellungen, etwa «Das Rote Biel» (Neues Museum 2021). Und noch etwas: Da das Jüdische Museum nur einen Teil des Nachlasses hat, würde ich notieren, wo sich die anderen Gegenstände befinden, um eine Übersicht zu haben.
NL: In dieser Synagoge hattest Du zusammen mit anderen Mädchen eine Bat Mitzwa Feier. Ihr wart die ersten Mädchen, die aus der Tora lasen. War Dir bewusst, was das für eine Zeitenwende war?
DE: Mir war das nicht bewusst, ich machte mir auch keine grossen Gedanken darüber. Eine Bat Mitzwa wurde nicht so ausgelassen wie heute gefeiert. Ich erinnere mich aber, dass sich meine Eltern sehr dafür einsetzten, dass in Biel auch Mädchen ihre Bat Mitzwa feiern durften. Anfang der 1980er Jahre war das nicht selbstverständlich. Wir waren vier Mädchen, drei Romandes und ich, die zusammen feierten. Ich erinnere mich an die mit Blumen geschmückte Synagoge und an ein gemeinsames Essen im Gemeindesaal. Kürzlich habe ich die Rede gefunden, die mein Vater für mich verfasst hat, mit einem Zitat aus dem Buch Ruth, das man an Schawuot liest.
NL: Liebe Dina, vielen Dank für Deine Erinnerungen.
verfasst am 15.05.2023
©Illustration: Marva Gradwohl