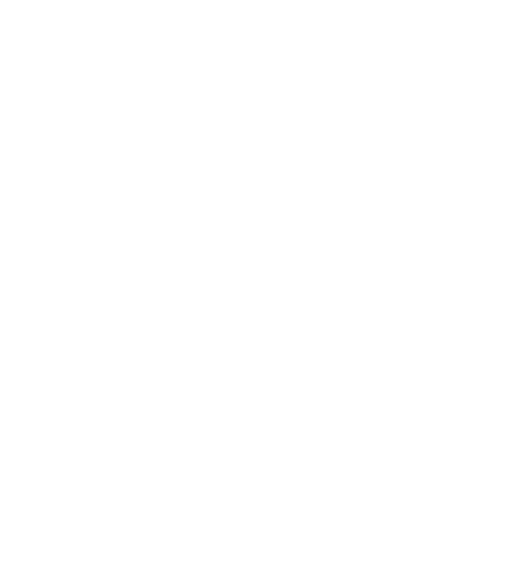«Ich habe einen Schtreimel in zwei Hälften geschnitten und zwei Hemden zusammengenäht.»
Fünf Fragen an
Akiva Weingarten
Rabbiner Akiva Weingarten beschreibt sich selbst mit dem unwahrscheinlichen Begriff «liberal-chassidisch». Er verliess 2014 die ultra-orthodoxe Satmar-Gemeinde und wurde 2019 Rabbiner von Migwan in Basel wie auch von der jüdischen Gemeinde in Dresden. Wenige Tage vor Beginn der Pandemie gründete er in Dresden die Besht Jeschiwa, die ehemalige Charedim unterstützt. Dieses Jahr veröffentlichte er seine Biografie, Ultra-Orthodox. Naomi Lubrich sprach mit ihm über seinen Weg, seine Pläne und sein berühmtes Porträt.
Naomi Lubrich: Akiva, Dein Buch «Ultra-Orthodox» ist dieses Jahr erschienen. Warum hast Du es geschrieben?
Akiva Weingarten: Ich bin ein Ex-Charedi, ein so genannter OTD, das Akronym für Menschen, die «Off the Derech» (deutsch: Abseits des Weges) sind. Als dieses Thema in den Fokus der Medien rückte, gab ich mehrere Interviews, unter anderem mit dem Spiegel, der Deutschen Welle und Arte. Ein Verleger las die Artikel und schlug mir vor, eine Biografie zu schreiben. Das habe ich dann getan. Die letzten zwei Jahre waren sehr intensiv. Neben dem Schreiben des Buches und dem Dienst in zwei Gemeinden habe ich eine Jeschiwa gegründet, um anderen OTDs zu helfen, den Weg in die Mehrheitsgesellschaft zu finden.
NL: Das ist eine grosse Verantwortung! Was sind die unmittelbaren Bedürfnisse der OTDs?
AW: Menschen, die die charedische Gemeinschaft verlassen, brauchen Unterricht in Naturwissenschaften und Sprachen, einen Schulabschluss, und eine stützende Infrastruktur. Es gibt viele, die aussteigen wollen, und es ist schwierig, ihnen allen zu helfen. Wir haben derzeit eine Warteliste mit 106 Personen, die Unterstützung benötigen. Wir wenden uns nicht einmal aktiv an sie. Wir machen keine Werbung. Die Leute kommen über Mundpropaganda zu uns. Früher waren es meist junge, unverheiratete Männer, von denen viele schwul waren. Jetzt sind es mehrheitlich Frauen.
NL: Können die jüdischen Gemeinden helfen?
AW: Bis zu einem gewissen Grad schon, aber Projekte wie diese müssen finanziert werden, und in Deutschland ist die Sozialpolitik meist staatlich. Es ist schwer, sich mit einem neuen Projekt einen Weg in die Strukturen der Wohltätigkeitsorganisationen zu bahnen.
NL: Du arbeitest zwischen Deutschland und der Schweiz. Wie unterscheiden sich die Gemeinden?
AW: Die Schweizer Gemeinden sind alt und gut etabliert; sie haben gemeinsame Werte und Verantwortlichkeiten, die über Generationen weitergegeben wurden. Die deutschen Gemeinden sind neu, sie werden oft von Neuankömmlingen geführt, von denen einige nur wenig oder gar kein jüdisches Erbe aus erster Hand haben. Es ist bemerkenswert, wie auffallend die nationalen Unterschiede zwischen den Gemeinden sein können: Nehmen wir die interreligiöse Ehe, eine der drängendsten Fragen unserer Zeit. Sie ist der Grund dafür, dass viele Gemeinden in Europa schrumpfen. In den Vereinigten Staaten hingegen wachsen die Gemeinden, die interreligiösen Ehen gegenüber aufgeschlossen sind. Sie zahlen jedoch einen Preis in Form von Zugeständnissen an die Halacha, das religiöse Gesetz.
NL: Dein Porträt von Frédéric Brenner ist in der Museumsszene berühmt geworden. Wie bist Du auf die Idee gekommen, ein Bild mit einem halben Bart und einem halben Schtreimel zu machen?
AW: [lacht] Tatsächlich wurde ich durch ein Foto im Internet inspiriert, von einem nicht-jüdischen Mann, der sich die Hälfte seiner Haare und seines Bartes abrasiert hatte. Auf die Frage, «warum?», antwortete er: «Weil ich es kann.» Das ist eine grossartige Einstellung. Und sie schien mir perfekt für eine Adaption durch Frédéric und mich. Also habe ich einen gebrauchten Schtreimel in zwei Hälften geschnitten und zwei Hemden zusammengenäht. Es hat Spass gemacht.
NL: Das kann ich mir vorstellen! Akiva, vielen Dank für Deinen Besuch.
verfasst am 29.09.2022
© Stephan Pramme