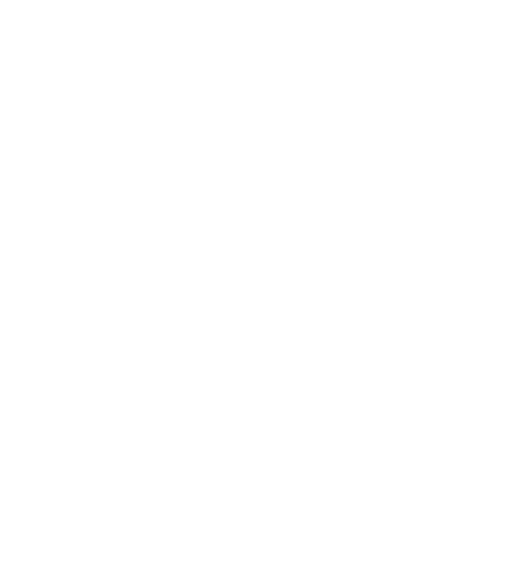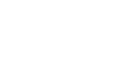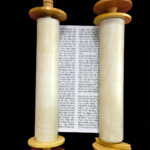Ein «Patchwork»-Talmud
Vier Fragen an
Anna Rabin
2018 machte unsere Kuratorin Anna Rabin eine Entdeckung: Im Talmud von 1578, der vom Basler Drucker Ambrosius Froben hergestellt wurde, waren fremde Seiten eingebunden. Diese Seiten stammten aus Venedig, aus der Werkstatt des Druckers Daniel Bomberg der Jahre 1522/8, sie waren also fünfzig Jahre älter. Anna Rabin erzählt im Gespräch mit Museumsleiterin Naomi Lubrich, was sie seither im Buch entdeckt hat.
NL: Anna, Du warst 15 Jahre lang Kuratorin im Jüdischen Museum der Schweiz. Was war das für ein Moment, als Du entdecktest, dass in einem unserer wichtigsten Bücher die Seiten nicht miteinander übereinstimmten?
AR: Es war ein Moment, der regelrechtes Herzklopfen auslöste: Ein ungläubiges «Das kann ja nicht sein!» oder ein erstauntes «Was ist denn da los?», das war das Erste, was mir einfiel. Dann kam der Moment, das Buch genau unter die Lupe zu nehmen und nach Möglichkeit vorbehaltslos und ruhig zu schauen, was wir denn vor uns haben. Als sich herausstellte, dass ein Teil der Drucke nicht aus Basel stammt, sondern aus der einzigartigen Werkstätte Bombergs in Venedig, da habe ich damit angefangen, ehrfurchtsvoll die Seiten umzublättern. Das Wissen, etwas ganz Besonderes und Einzigartiges in den eigenen Händen haben zu dürfen, das ist ein erhabener Moment, von dem jeder Museumsmitarbeiter träumt.
NL: Weshalb die verschiedenen Drucke zusammengebunden wurden, lässt sich heute nicht mehr ermitteln. Aber Du hast seither sämtliche handgeschriebene Notizen entziffert, um die Nutzung des Buches zu studieren. Was war Deine grösste Herausforderung?
AR: Ich hatte mit drei grossen Herausforderungen umzugehen. Die erste war, unvoreingenommen zu bleiben und in die Notizen nicht etwas hineinlesen zu wollen, was womöglich gar nicht da stand. Die zweite bestand im Verstehen und Entziffern der Handschriften selbst. Keine Handschrift gleicht der anderen. Die dritte war der immense Zeitfaktor: Ich bin über einen langen Zeitraum immer wieder die Inschriften durchgegangen, um Entzifferungen zu überprüfen, eventuell zu korrigieren oder auch zu revidieren. Das brauchte Ruhe, Durchhaltevermögen und viel Nerven.
NL: Was hast Du entdeckt?
AR: Aus den handschriftlichen Notizen lässt sich vermuten, dass das Buch in den vergangenen vierhundert Jahren in verschiedenen jüdischen Gemeinden im süddeutschen und tschechischen Raum verwendet wurde. Ein Traktat war in der Stadt Usov (heutiges Tschechien) in Gebrauch. Manche Handschriften lassen sich als «Sulzburg» lesen, eine andere lautet «Metz», wobei diese Interpretation nicht gesichert ist, denn der hebräische Text lässt eine gewisse Bandbreite an Varianten von Vokalisationen zu. Gleichwohl läge es nahe, dass der Foliant in der näheren Umgebung verwendet wurde, weshalb die Lesart Sulzburg nicht unwahrscheinlich ist. Für Metz ist eine jüdische Gemeinschaft im achtzehnten Jahrhundert nachgewiesen, die auch Gelehrte hervorgebracht hatte.
NL: Wie stellt man sich die dortigen Gelehrten vor?
AR: Man weiss nicht genau, wie sie unterrichtet haben. Aber wir wissen, dass diese Gemeinden bescheiden lebten. Die Gelehrten widmeten einen Grossteil des täglichen Lebens dem Studium religiöser Schriften, solange Tageslicht vorhanden war. Der Talmud wäre ihnen eine ausserordentlich kostbare kulturell-religiöse Quelle des Wissens gewesen.
NL: Vielen Dank!
Anna Rabin ist heute Mitarbeiterin am Albert Einstein Archiv in Jerusalem.
verfasst am 06.07.2022
Photo: Die Restauratorin Silvana Schmid restauriert den Talmud.
© Elwira Spychalska