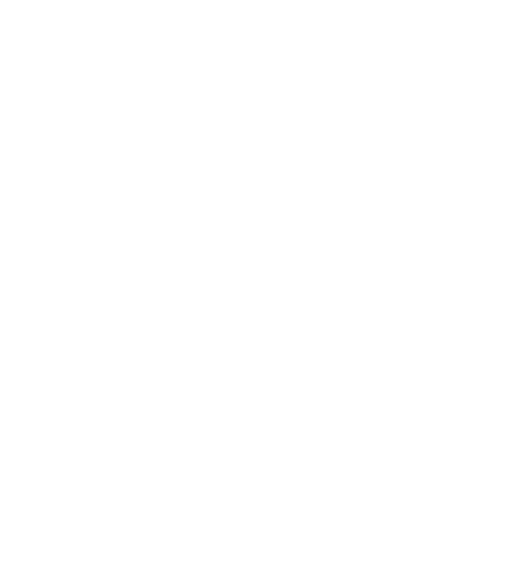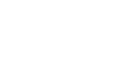Dinah Ehrenfreund im Jüdischen Museum der Schweiz,
Bernhard Friedländer, Krug für Kiddusch-Wein, Düsseldorf 1913-1926, JMS 1550.
Bernhard Friedländer, Lulav- and Etrog Holder, Düsseldorf oder Tel Aviv 1925-1940, JMS 764.
Bernhard Friedländer, Seder-Tafelaufsatz, Düsseldorf, 1913-1926, JMS 529.
«Mir geht es um die Neugierde für aussergewöhnliche Gestaltung»
Dinah Ehrenfreund über
den Silberschmied
Bernhard Friedländer
In der Sammlung des Jüdischen Museums der Schweiz entdeckte Kuratorin Dinah Ehrenfreund drei Werke Bernhard Friedländers, eines heute nahezu vergessenen Silberschmieds. Museumsleiterin Naomi Lubrich fragte sie zu Friedländers Bedeutung für die Judaica-Designgeschichte und zur Erschliessung von Kunstschaffenden, die heute zu Unrecht vergessen sind.
Naomi Lubrich: Liebe Dinah, Du hast in unserem Depot Judaica des Silberschmieds Bernhard Friedländer identifiziert. Wer war er?
Dinah Ehrenfreund: Bernhard Friedländer wurde um 1880 in Czenstochau, im heutigen Polen, geboren. Er machte seine Ausbildung als Gold- und Silberschmied sowie als Steinfasser in Lodz, Odessa, Tiflis und Berlin. Ab 1904 arbeitete er in Deutschland, mit Stationen in Berlin, München, Essen und Bonn. 1913 machte er sich in Düsseldorf selbständig und fertigte einzigartige Judaica für Synagogen sowie für den Haushalt. Seine Werke fanden Erfolg: Er stellte in Ausstellungen wie die GeSoLei in Düsseldorf 1926 aus, in den USA 1927 sowie bei der Kult- und Form-Ausstellung in verschiedenen Städten ab 1930. Sein Handwerk wurde in Zeitungen und Lexika gewürdigt. Die Zeit in Düsseldorf, wo er bis 1928 blieb, war seine künstlerisch kreativste. 1928 zog er nach Antwerpen, und 1932 wanderte er nach Tel Aviv ins damalige Mandatsgebiet Palästina aus. Dort schuf er neben einzigartigen Chanukka-Leuchtern vor allem Judaica und Silberwaren in vielfacher Ausführung – Massenware, wenn man so will. Friedländer starb 1941.
NL: Bernhard Friedländer ist heute nahezu unbekannt. Warum?
DE: Die meisten Werke, die er in seiner Zeit in Deutschland schuf, wurden in der NS-Zeit zerstört. In Tel Aviv stellte er Kerzenständer, Chanukka-Leuchter, Kiddusch-Becher und Tafelsilber her, die künstlerisch weniger anspruchsvoll, weniger aussergewöhnlich sind. Wer in Israel seinen Namen nicht kennt, kennt vielleicht seine Firma Michsaf. Sie besteht noch heute, allerdings ist sie nur noch symbolisch mit Friedländer verbunden, er hatte sie zu Lebzeiten verkaufen müssen. Ein anderer Grund, weshalb Friedländer heute wenig bekannt ist, ist, dass er 1941 mit sechzig Jahren vergleichsweise früh starb. Zum Vergleich: der heute sehr angesehene Kunsthandwerker Jehuda Wolpert lebte bis 1981. Er arbeitete übrigens zwei Jahre in Friedländers Tel Aviver Werkstätte und danach als Lehrer in der Bezalel-Kunstschule. Wolpert schuf moderne Kultgegenstände und erreichte damit ein grosses Publikum. Heute gilt er als Erfinder der modernen Judaica, was allerdings die innovative Arbeit vieler anderer Künstler und Künstlerinnen in Deutschland vor 1938, wie Bernhard Friedländer, nicht gebührend Rechnung trägt.
NL: Du hast eine Seder-Platte in der JMS-Sammlung näher studiert. Was ist daran besonders?
DE: Die Seder-Platte stammt aus dem Jahr 1925/26. Sie hat eine ungewöhnliche, decagonale, d.h. zehneckige, Form. Entlang des Randes sind Abbildungen biblischer und historischer Szenen von den Urvätern bis in die Gegenwart dargestellt. Die hebräischen Inschriften enthalten literarische Verweise. Über dieses Stück im Zentrum der Seder-Tafel könnte man den ganzen Abend lang sprechen!
NL: Es war also nicht Deine ästhetische Vorliebe, die Dich an Bernhard Friedländer herangeführt hat.
DE: Nein, denn ich interessiere mich für die Geschichten der Objekte, wie sie ins Museum gelangt sind und als was sie zuvor verwendet wurden. Mir geht es weniger um einen ästhetischen Geschmack als um die Neugierde für aussergewöhnliche Gestaltung. Die haben Bernhard Friedländers Objekte zweifelsfrei!
NL: Liebe Dinah, vielen Dank für diesen Einblick in Judaica Design.
verfasst am 05.02.2024