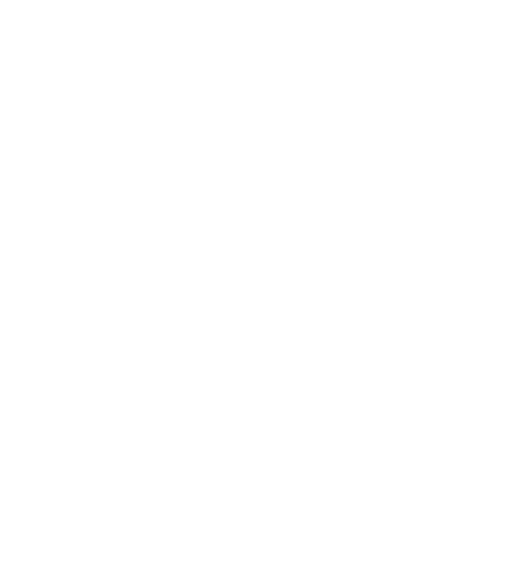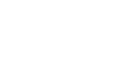«Von dem Frohsinn junger Menschen war im Museum nichts zu verspüren»
Alliya Oppliger blickt zum 60. Jahrestag auf die Ausstellung Monumenta Judaica zurück
Die Kölner Ausstellung Monumenta Judaica. 2000 Jahre Geschichte und Kultur der Juden am Rhein war am 15. Oktober 1963 eröffnet worden; sie war die erste grosse Ausstellung zur jüdischen Religion und Kunst des Rheinlands. Alliya Oppliger, angehende Historikerin und Praktikantin im Jüdischen Museum der Schweiz erforschte die Geschichte der Monumenta Judaica zum Anlass ihres sechzigsten Jahrestages. Museumsleiterin Naomi Lubrich befragte sie zu deren Bedeutung und Nachhall.
Naomi Lubrich: Liebe Alliya, 1963/64 war die Ausstellung Monumenta Judaica im Kölner Stadtmuseum zu sehen. Wie muss man sie sich vorstellen?
Alliya Oppliger: Die Ausstellung war gross und umfassend. Ihr Anspruch war, 2000 Jahre Geistes- und Gemeindeleben der Jüdinnen und Juden am Rhein zu zeigen, von Basel nach Emmerich. 2200 Leihgaben waren aus 15 Ländern aus Bibliotheken und Museen in Washington, dem Vatikan, Moskau, London, Wien, Kopenhagen, Budapest, Amsterdam und natürlich Deutschland dafür zusammengetragen.
NL: Gab es einen besonderen Anlass für die Ausstellung?
AO: Ja, einer der Gründe war politisch: Im Dezember 1959 war die Kölner Synagoge in der Roonstrasse beschmiert worden, und diese Schmierereien hatten eine Welle antisemitischer Vorfälle in ganz West-Deutschland ausgelöst. Eine Informationskampagne sollte Abhilfe schaffen. Zunächst erwog man, eine Ausstellung in Recklinghausen namens Synagoga nach Köln zu holen. Synagoga (1960/61) war die erste grössere Ausstellung zum Judentum in der deutschen Nachkriegszeit. Sie hatte prächtige jüdische Kultgegenstände zur Schau gestellt. Stattdessen aber entschied man, eine eigene Ausstellung mit einem anderen Fokus zu machen. Die Kölner Ausstellung orientierte sich an die regionalgeschichtlichen Ausstellungen der Weimarer Zeit, insbesondere an der jüdischen Abteilung der Jahrtausendausstellung des Rheinlandes 1925.
NL: Wer finanzierte die Ausstellung?
AO: Die Kosten trugen die Stadt Köln zu einem Drittel und die Bundes- und der Landesregierung zu einem weiteren Drittel; das letzte Drittel kam aus dem Erlös durch den Verkauf von Eintritten und Publikationen.
NL: Kannst Du etwas zum Konzept sagen?
AO: Die Ausstellung war pädagogisch motiviert. Sie hob das Zusammenleben der Juden und Christen hervor und die gegenseitige Befruchtung der Religionen und Kulturen. Knapp zwanzig Jahre nach Kriegsende wollte sie das antijüdische Zerrbild der Nazis korrigieren. Viele Ideen waren damals innovativ, zum Beispiel wollte man vermeiden, die jüdische Geschichte lediglich als Verfolgungsgeschichte zu zeigen. Man wies darauf hin, dass die Jüdinnen und Juden durch die Umgebungskultur geprägt waren. Anders als andere Ausstellungen sollte auf prominente Biografien verzichtet, stattdessen das Leben normaler Menschen gezeigt werden.
NL: Was war die Resonanz auf die Ausstellung?
AO: Die Ausstellung war gut besucht: 114.450 Personen kamen, darunter Gruppen aus der Kirche, aus dem Bildungswesen, der Streitkräfte sowie der Politik, z.B. der Präsident der Bundesrepublik Deutschland Heinrich Lübke, Kardinal Frings, der vormalige israelische Ministerpräsident Moshe Sharett, der Präsident der World Zionist Organisation Nahum Goldmann und den Mitbegründer des Leo Baeck Instituts, Siegfried Moses. Der Wunsch, die Jugend anzusprechen, gelang: Über 61 Prozent der Besucher, 70.232 Personen, waren Jugendliche und junge Erwachsene. Mehrere Journalisten bemerkten, dass die Ausstellung sie zur Beschäftigung mit der deutschen Vergangenheit inspirierte. Der Rechtsanwalt Curt C. Silbermann beobachtete in der deutsch-jüdischen Exilzeitung Aufbau beispielsweise:
«Von dem Frohsinn junger Menschen war im Museum nichts zu verspüren; sie waren außerordentlich ernst und fühlten sich einigermaßen unsicher in einer Umgebung, die ihnen fremd oder vom Elternhaus verzerrt geschildert war. Wenn man diese Gruppe junger Menschen als Maßstab nehmen kann, so ergibt sich als positives Resultat, daß diese Jugend den Kontakt sucht, um zu lernen und um sich eine unabhängige, d.h. von ihrem Elternhaus unabhängige Vorstellung zu machen. Dabei muß zugegeben werden, daß eine Begegnung mit Museumsobjekten trotz aller guten Erklärung durch Wort und Schrift nicht eine Begegnung mit dem lebenden Organismus ersetzen kann.» (7. Februar 1964).
NL: Das ist interessant! Über die Auswirkungen der Museen auf die Gesellschaft hören wir gerne. Liebe Alliya, vielen Dank für diese Einsicht in Monumenta Judaica, die Ausstellung, die auch die Gründung des Jüdischen Museums der Schweiz inspirierte.
verfasst am 16.10.2023