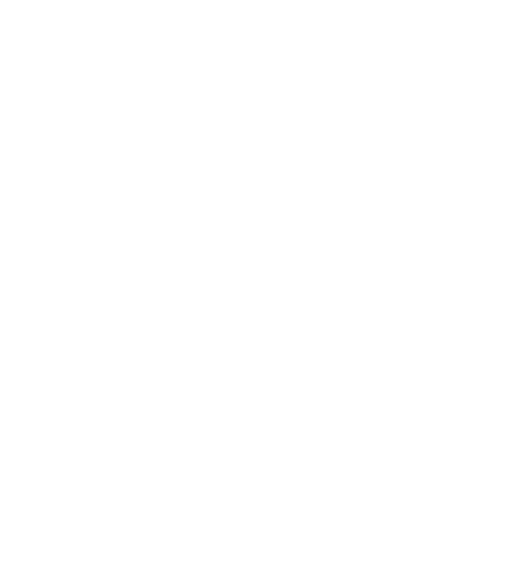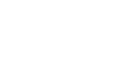«Superman ist eine Moses-Geschichte.»
Vier Fragen an Thomas Nehrlich
Thomas Nehrlich ist Literaturwissenschaftler an der Universität Bern. Er erforscht Geschichten von Heldinnen und Helden aus der Vergangenheit und der Gegenwart. Dabei beleuchtet er ihren Bezug zu gesellschaftlichen Strukturen, zur Regierungsform – und zum Judentum. Naomi Lubrich fragte ihn zum Faszinosum Heldenliteratur, zu jüdischen Vorbildern und zur aktuellen Berichterstattung.
Naomi Lubrich: Lieber Thomas, Du beschäftigst Dich mit Heldenfiguren. Was interessiert Dich daran?
Thomas Nehrlich: Mein Interesse an Heldentum hat zunächst einfach einen biographischen und persönlichen Hintergrund. Wie viele Menschen bin ich mit den Geschichten von Heldinnen und Helden aufgewachsen, mit Jim Knopf und Ronja Räubertochter, mit griechischen Mythen und Abenteuerromanen, später auch mit heroischen Figuren aus Fantasy und Science Fiction und den Superhelden. Heroismus ist ein häufiges Element sehr vieler literarischer und populärkultureller Werke. Diese Erzähltradition, vielleicht die längste der Menschheitsgeschichte, beschäftigt mich als Literaturwissenschaftler. Sie ermöglicht uns einen Zugang zu ganz alten Überlieferungen, etwa dem rund 4000 Jahre alten babylonischen Gilgamesch-Epos, und zu Artefakten aus anderen Kulturen, etwa den japanischen Manga. Anhand der Darstellung von Heldinnen und Helden in der Literatur und Kunst erfahren wir sehr viel über die Gesellschaften und Epochen, aus denen sie stammen.
NL: Das Judentum spielt in Deiner Forschung eine Rolle. Was ist der Bezug?
TN: Die religiösen Erzählungen des Judentums gehören zu den bekanntesten und wichtigsten Heldentraditionen unserer Kultur. Josef, Moses, Josua, David, Judit, Ester – sie alle tragen heroische Züge. Der Tanach, die hebräische Bibel, ist ein Füllhorn des Heroismus. Und die Gefahren und Schwierigkeiten, mit denen diese alten Heldenfiguren konfrontiert sind, lassen sich mit der jüngeren Vergangenheit und zum Teil der Gegenwart vieler Jüdinnen und Juden in Beziehung setzen: Verfolgung, Diaspora, Diskriminierung, Gewalt. Besonders interessiert mich die Rezeption und Adaption der jüdischen Figuren in den Geschichten der Superhelden. Der übermenschlich starke Krieger Simson etwa wird schon in der Bibel wie ein Superheld dargestellt, mit einer geheimen Kraftquelle, die zugleich seine Schwachstelle ist: sein Haar, das ihm Delila abschneidet. Simson stand, zusammen mit Helden wie Achilles und Siegfried, die ähnlich funktionieren, geradezu Modell für die Superhelden.
NL: Superman, der Grossvater der Superhelden, wurde von zwei US-amerikanischen Juden 1938 erfunden. War das Zufall?
TN: Jerry Siegel und Joe Shuster waren Ende der 1930er Jahre Teenager, als sie Superman erfanden. Sie waren Kinder jüdischer Immigranten, die aus Europa in die USA geflüchtet waren. Diese Herkunft teilten sie mit vielen der bedeutendsten frühen Superhelden-Autoren und ‑Zeichner, etwa mit Will Eisner, Bill Finger, Bob Kane, Jack Kirby und Stan Lee, die Figuren wie Batman, Captain America und Spider-Man erschufen. Sie alle hatten entfesselten Antisemitismus selbst erlebt oder kannten ihn als Trauma ihrer Eltern. Auch in den USA lebten sie als Einwanderer zunächst unter prekären Bedingungen. Dass sich traumatisierte, sozial ausgegrenzte und ökonomisch benachteiligte Jugendliche übermächtige Heldenfiguren ausdenken, in deren Abenteuern sie ihre Träume verwirklichen und für einen Moment der Realität entfliehen können, ist nicht verwunderlich. Dabei flossen in die neuen Helden auch die alten jüdischen Erzähltraditionen ein. Superman selbst ist von Rabbinern wie Simcha Weinstein und Avichai Apel mit Moses verglichen worden: Beide Helden werden von ihren leiblichen Eltern zu ihrem Schutz ausgesetzt und von Zieheltern aufgezogen, bevor sie sich gegen Unterdrückung und Unfreiheit wenden und zu verehrten Beschützern ihrer Landsleute werden. Deutlich wird das jüdische Erbe der Superhelden auch in ihrer Politik. Im Zweiten Weltkrieg erschienen Comics, in denen sie Adolf Hitler zur Strecke bringen und den Holocaust zu beenden versuchen. Später sensibilisierten die X‑Men die Mehrheitsgesellschaft für die Erfahrungen von Minderheiten und engagierten sich gegen Diskriminierung jeder Art. Auch wenn uns Superhelden heute in Form einer milliardenschweren Industrie begegnen, die Comics, Filme und Merchandising am laufenden Band produziert, sind sie von ihren Ursprüngen her jüdisch, antifaschistisch und egalitär.
NL: Braucht unsere Gesellschaft heute noch Heldengeschichten, oder haben sie ausgedient?
TN: Das ist eine schwierige Frage, bei der ich selbst zwiegespalten bin. Einerseits können heroische Figuren moralische und gesellschaftliche Werte vermitteln. Sie können Menschen über kulturelle Grenzen hinweg miteinander verbinden. Heldengeschichten sorgen ausserdem schlicht für gute Unterhaltung. Der jahrtausendelange Erfolg des Heroismus scheint mir zu belegen, dass er eng mit der menschlichen Zivilisation verknüpft ist. Vielleicht sind Erzählen, Kunst, Kultur und Fortschritt ohne heroische Vorbilder gar nicht denkbar. Andererseits geht Heldentum fast immer mit Kampf und Gewalt einher. Und in ihrer herausgehobenen Machtstellung, in der sie allein entscheiden und eigenmächtig handeln, wirken Helden selbstherrlich und undemokratisch. Diese Schattenseiten des Heldentums halten heute viele aus guten Gründen für obsolet. Die Politik- und Kulturwissenschaften bezeichnen diese Haltung, die sich seit Mitte des 20. Jahrhunderts stark verbreitet, als Postheroismus. Überwunden aber scheint mir Heldentum definitiv nicht. Das sieht man übrigens an der westlichen Berichterstattung zum Angriff Russlands auf die Ukraine, die den Heldenmut ukrainischer Soldaten hervorhebt. In diesem Krieg gegen ein autokratisches Regime scheinen unsere demokratischen Gesellschaften ihre alte Bewunderung für Helden teilweise wiederzuentdecken, selbst für gewaltsame. Heldengeschichten entstehen vor allem, wo Schrecken herrscht. Mir wäre es lieber, wenn sie nicht nötig wären.
NL: Lieber Thomas, vielen Dank für diese Zusammenfassung – und auch für die folgenden Lesetipps:
Jens Meinrenken: Eine jüdische Geschichte der Superhelden-Comics. In: Helden, Freaks und Superrabbis. Die jüdische Farbe des Comics. Herausgegeben von Margret Kampmeyer-Käding und Cilly Kugelmann. Berlin: Jüdisches Museum Berlin 2010, S. 26–38.
Reader Superhelden. Theorie – Geschichte – Medien. Herausgegeben von Lukas Etter, Thomas Nehrlich und Joanna Nowotny. Bielefeld: transcript 2018.
verfasst am 23.02.2023

Tabea Buri über den Sammler Eduard Hoffmann-Krayer