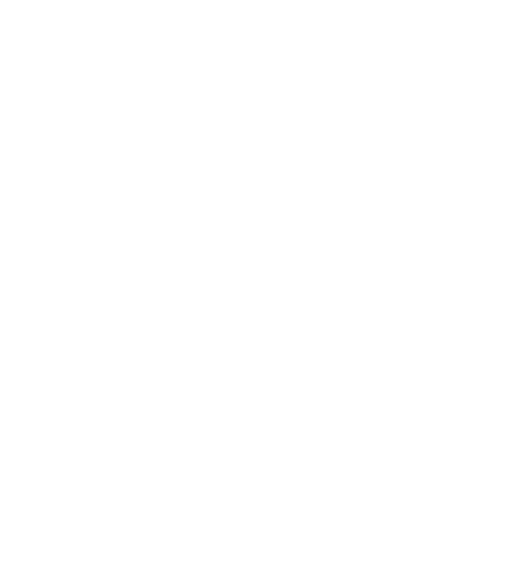Kunst im Museumshof
Ein Gespräch mit Fabio Luks
Steine mit Eigenleben
Fabio Luks im Gespräch mit Dr. Naomi Lubrich, der Direktorin des Jüdischen Museums der Schweiz.
NL: Herr Luks, Sie sind ein konzeptuell arbeitender Künstler. Sie produzieren Worte, Sie kommentieren Räume. Vor dem Kunsthaus Grenchen installierten Sie lebensgross das Wort «Jetzt», das in sich zusammenfällt. Im Jüdischen Museum der Schweiz stellen Sie im Hof zwischen mittelalterlichen Grabsteinen Nachbildungen mit dem hebräischen Wort CHAI («lebendig») her. Ist das Reduktion, oder ist das Ironie?
FL: Ja, Sie liegen mit «Ironie» nicht ganz falsch: Ich lese gerade ein Buch, das die These vertritt, dass die Kunst und der Witz Pointen setzen müssen. Die Pointe bei CHAI wäre, dass die Grabsteine den Toten gedenken, sie aber insofern lebendig halten, als dass sie die Erinnerung an sie bewahren. Aber auch die «Reduktion» ist nicht verkehrt. Denn meine Arbeit entwickelte sich zur immer grösseren Prägnanz. Habe ich zunächst ganze Gedankengänge formuliert, so wurden das später kurze Phrasen und zuletzt einzelne Worte. Seit ich als Künstler tätig bin, fasse ich mich immer kürzer.
NL: Das wäre in unserem Fall die Entwicklung von «Grabsteinen, die vom Leben erzählen» zu «lebendig»?
FL: Das Wort «Chai», also «lebendig», kam mir sofort in den Sinn für die Installation im Innenhof des Museums. Das Leben hat im Judentum den höchstmöglichen Stellenwert. Das Leben ist uneingeschränkt schützenswert. Und das Leben ist mit dem Wort eng verbunden. Ich denke an den Golem, der durch das Wort zum Leben erwacht. Er besteht aus Ton, aber als Rabbi Löw ihm magische Schriftzeichen einritzt, erhält er ein Wesen. In gewisser Weise ist das bei den Grabsteinen nicht anders. Vor achthundert Jahren schrieb man die Namen der Toten auf Steinen. Heute sind es diese Zeichen, die den Steinen eine Bedeutung, ein Eigenleben geben. Sie machen aus Mineralien Menschen.
NL: Wie kamen Sie zur Kunst? Wann haben Sie es sich erstmals zur Aufgabe gemacht, ein Wort in Grossformat zu produzieren?
FL: Zu Beginn habe ich Textbilder gemalt und willkürlich aufgeschrieben, was mir durch den Kopf ging, wie beim automatischen Schreiben. Mich interessierten aber bald mehr die Texte, weniger die Bilder. Ich wollte mit Worten den Moment einfangen. Ich wollte die Betrachter direkt ansprechen. Ich suchte Worte, die mehrdeutig und spielerisch sind. Bald traf ich die Entscheidung, die Bilder wegzulassen und mich nur auf den Text zu konzentrieren. Das war, wenn man so will, eine selbst aufgelegte Einschränkung.
NL: Einschränkungen fördern bekanntlich Kreativität…
FL: (Lacht). Das sagen Sie! Vielleicht greife ich bald wieder auf die Bilder zurück, denn die Einschränkungen machen kreativ, aber nur für eine gewisse Zeitspanne, zumindest bei mir.
NL: Wer sind Ihre künstlerischen Vorbilder?
FL: Mich interessieren vor allem Künstler des 20. Jahrhunderts: Marcel Duchamp, die Nouveaux Réalistes, Jean Tinguely, die Fallenbilder von Daniel Spoerri, Pop Art, Martin Kippenberger, Jean-Michel Basquiat und Thomas Hirschhorn. Sie sind das Panorama meiner «male influence», wenn man so will.
NL: Sie sind jedenfalls alle Künstler mit Humor.
FL: Genau.
NL: Sie studierten zunächst Philosophie und Judaistik in Basel. Wie prägte das Studium Ihre Kunst?
FL: Sowohl Philosophie wie auch Judaistik sind textverliebte Fächer, sie laden zum Assoziieren ein, sie fassen Begriffe. Ich erinnere mich an fruchtbare Diskussionen zu Themen wie Autorschaft, Zeugnisse, Notizen. Ganze Seminare widmeten sich Fragen wie «Was ist ein Moment?», «Wie kann man einen Augenblick einfangen?», «Gibt es ein ‹Jetzt›, das nicht immer schon weg ist?» Das sind Themen, die ich in meiner Arbeit behandle.
NL: Und Judaistik?
FL: Die Verwerfung des Bildes, die Besinnung auf den Text – ist das nicht ein idealtypisch-jüdischer Weg?
NL: Was lernt man im Studium zum jüdischen Bilderverbot?
FL: Vom Bilderverbot wusste ich lange vor dem Studium, ich machte mir aber vor meiner Zeit als Künstler nie dazu Gedanken. Demnach müsste jüdische Kunst immer eine abstrakte Kunst sein. Das hätte aber ein Künstler wie Chagall sicherlich anders gesehen.
NL: Juden gelten als «Volk des Buches».
FL: Ja, ich denke an den Begriff des «portativen Vaterlands» vom Schriftsteller Heinrich Heine. Sprache und Texte prägen unser Leben – das ist etwas, was mich immer wieder fasziniert. Wir leben alle in unseren Fiktionen.
NL: Und das bestimmende Thema unserer Zeit, die Identität? Bei Ihnen sehe ich nicht auf den ersten Blick eine starke Auseinandersetzung mit dem eigenen Partikularismus.
FL: Das kommt vielleicht noch! (Lacht). Ich entwickle tatsächlich gerade ein Projekt zur Identität – allerdings zur Identität des Künstlers und dessen Rolle in der Gesellschaft. Die Kunst ist heute, anders als bei den grossen Meistern, kein klares Berufsfeld mehr. Die meisten Künstlerinnen und Künstler können nicht davon leben. Gleichzeitig bilden die Kunstschulen immer mehr Studierende aus. Und die Erwartungen an die Kunst sind riesig.
NL: Der Künstler als moderner Messias? In Ihrem Werk jedenfalls kein rein «jüdischer»; denn neben der jüdischen Tradition bedienen Sie sich anderer Traditionen. Die Farbkombination der Paneele haben Sie aus dem Buch A Dictionary of Color Combinations von Sanzo Wada. Ist es ein bewusstes postmodernes Referencing, das Sie machen – oder einfach der Spiegel einer Zeit des weit verbreiteten Zitierens?
FL: Ich bin offen gegenüber Künstlerinnen, Quellen und Ideen und möchte nicht jede Einzelheit selbst entscheiden. Ich greife auf Hilfsmittel zurück, ohne mir den Kopf zu zerbrechen. Bewusstes und unterbewusstes Zitieren gehört bei mir einfach dazu.
NL: In der Zeit der fortschreitenden Digitalisierung produzieren Sie analoge Objekte per Hand. Sie arbeiten nicht am Screen, nutzen keinen 3‑D-Druck. Ihre Arbeitsweise ist kaum anders als in biblischen Zeiten. Ist das Teil Ihres künstlerischen Konzepts?
FL: Naja, also wie in biblischen Zeiten ist das nicht. (Lacht). Und auf die Gefahr hin, Sie sehr zu enttäuschen, sind die Materialien, die ich nutze, neu und innovativ. Es sind Hartschaumplatten, die leicht und einfach zu schnitzen sind. Ich beschichte sie mit Acrystal und bemale sie mit Acryl. Und ich mache tatsächlich Visualisierungen am Screen. Ich wäre auch nicht abgeneigt, einen 3‑D-Drucker zu verwenden, sollten sich Projekte ergeben, für die der 3‑D-Druck sinnvoll (und finanzierbar) wäre. Aber ich arbeite nicht gerne ausschliesslich am Rechner. Ich mag die körperliche Arbeit sehr gerne. Und durchaus auch den Dialog – sogar Interviews.
NL: Das verstehe ich als sympathischen Hinweis. Vielen Dank für das Gespräch.
verfasst am 17.12.2021
Foto © Harald Neumann